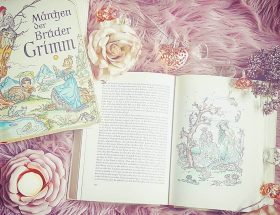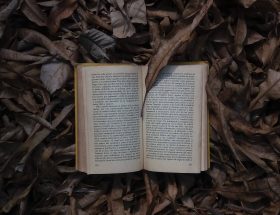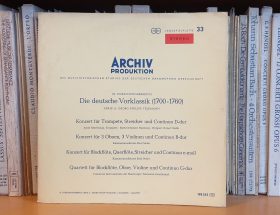Wir betonen es ja immer wieder: Betrachten wir Märchen, dürfen wir nicht die historischen Hintergründe außer Acht lassen. In unserer aktuellen Folge „Zwei Brüder, ein Irrglaube und jede Menge Romantik“ beleuchten wir den zeitgeschichtlichen Kontext genauer und sprechen über Märchen und die Romantik-Epoche.
Die Romantik-Epoche: der Kontext der Märchen
Es ist ja bereits in vielen Folgen deutlich geworden, insbesondere wenn es um so diskutable Themen die Frauen im Märchen (Folge 11, „Von Rebellinnen, Fischgarn und einem Glasberg“) oder „Diversität im Märchen“ (Folge 15, „Die Diversity-Challenge“) ging: Märchen können nicht losgelöst von ihrem zeitgeschichtlichen Kontext betrachtet werden. Zum einen ist es ohne zeitgeschichtlichen Kontext nicht möglich, Märchen in ihrer Tiefe zu verstehen. Zum anderen ist eine Diskussion über Märchen ohne die Berücksichtigung der Zeit, in der sie entstanden sind, unvollständig, ja sogar inhaltslos – denn dass sich die Norm- und Wertevorstellungen von vor über 300 Jahren nicht auf unsere heutige Zeit übertragen lassen, bedarf ja nicht wirklich irgendeiner Diskussion, oder?
Doch wisst ihr auch, was Romantik heißt? Mustert die Muster in eurem Geist. Romantik weicht von der Dichtkunst nie, sie ist ihre Mutter: die Phantasie
Franz Grillparzer, 1791-1872
Ein Blick auf die Zeitgeschichte
In unserer Märchenkunde in Folge 21, „Zwei Brüder, ein Irrglaube und jede Menge Romantik“, klären wir unter anderem die Frage, was zeitgeschichtlicher Kontext eigentlich bedeutet. Letztlich geht es dabei um nichts anderes, als sich anzusehen: Was waren die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ereignisse dieser Zeit?
Das ist wichtig, weil derartige Ereignisse das Denken der Menschen beeinflusst und damit Auswirkungen auf ihr Weltbild haben. Und genau das ist es, was Literatur verarbeitet. Literatur ist immer ein Spiegel ihrer Zeit, eine Auseinandersetzung mit den zeitgeschichtlichen Begebenheiten, zustimmend oder ablehnend, kritisch oder begeisternd.
Die Literaturepochen
Hier kommen die Literaturepochen ins Spiel. Sie bezeichnen einen Abschnitt in der Literaturgeschichte, der durch bestimmte Ereignisse und Denkweisen geprägt war, die sich in Form bestimmter Merkmale, Motive und Themen in der Literatur widerspiegeln. Dabei können Epochen unterschiedlich lang sein, wenige Jahre oder sogar mehrere Jahrhunderte.
Unabhängig von ihrer Länge sind Epochen aber nichts Statisches. Das bedeutet, sie können nicht eindeutig voneinander getrennt werden, weil sie sich immer gegenseitig beeinflussen, bedingen und zum Teil auch parallel verlaufen. Das seht ihr schon, wenn ihr euch die Jahreszahlen einzelner Epochen anschaut. Ihr werdet einige Überschneidungen feststellen.
➸ Übrigens: Wir sprechen hier von der Literaturepoche der Romantik. In der Musik oder der Architektur verlief die gleichnamige Epoche anders und umfasst auch einen ganz anderen Zeitraum.
Die Phasen der Romantik
Die Epoche, in der die Brüder Grimm ihre Märchen sammelten und veröffentlichten, ist die Romantik. Wer jetzt an flackernden Kerzenschein, einen goldenen Sonnenuntergang oder innige Liebesschwüre denkt – leider nein, leider gar nicht. Das, was wie heute unter Romantik verstehen, hat mit dem Selbstverständnis der Literaturepoche Romantik eher wenig zu tun. Zwar stellt sie durchaus Gefühl und Leidenschaft in den Fokus, allerdings auf einer anderen, mythischen Ebene.
Aber ordnen wir die Epoche erst einmal zeitlich ein. Die Romantik umfasst den Zeitraum von 1795 bis 1848 und kann in drei Phasen unterteilt werden:
- Frühromantik (1798 – 1804)
- Hochromantik (1805 – 1814)
- Spätromantik (1818 – 1840)
In diesen Phasen waren verschiedene Themen unterschiedlich ausgeprägt.
Die Frühromantik
Die Frühromantik setzt sich intensiv mit antiken Mustern, wie sie in der Weimarer Klassik (1786–1832) verehrt wurden, auseinander und wandte sich von diesen ab. Ihr Zentrum lag in der Universitätsstadt Jena, die damals als geistige Hochburg Europas galt und der Frühromantik deshalb zu einem weiteren Namen verhalf: die Jeaner Romantik. Bedeutende Geisteswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen arbeiteten dort zusammen und entwickelten, erstmal ganz theoretisch, das romantische Weltbild. Die Frühromantik wird außerdem auch als „Ältere Romantik“ bezeichnet.
Wichtige Autoren dieser ersten Phase der Romantik-Epoche waren August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel und Friedrich von Hardenberg, besser bekannt unter dem Pseudonym Novalis.
Die Hochromantik
Die Hochromantik hatte ihr Zentrum in Heidelberg, weshalb für sie auch die Bezeichnung „Heidelberger Romantik“ gebräuchlich ist. Da ihre Vertreter und Vertreterinnen jünger waren als die der Frühromantik, wird sie zudem als „Jüngere Romantik“ bezeichnet.
Die Hochromantik war die Hochphase der Sammlung und Herausgabe mittelhochdeutscher Dichtung – und die Wirkens- und Schaffenszeit der Brüder Grimm. Ihr Anliegen war es, deutsche Erzählungen zu sammeln und zu bewahren, denn es ging um die Schaffung einer eigenen Identität und eines eigenen Nationalgefühls. Weitere wichtige Schriftsteller, mit denen die Grimms auch im Austausch standen, sind Clemens Brentano und Achim von Arnim.
Die Spätromantik
Die Spätromantik, auch „Berliner Romantik“, weil ihr geistiges Zentrum in Berlin lag, legte den Fokus auf das Mystische und Unheimliche. In dieser Phase entwickelte sich die Schwarze Romantik, eine Unterströmung der Romantik, die durch sehr düstere und melancholische Züge geprägt ist. Außerdem kehrten in der Spätromantik viele Dichter*innen zum katholischen Glauben zurück oder konvertierten.
Zu den bekanntesten Vertreterinnen und Vertretern der Spätromantik gehören unter anderem Bettina von Arnim, Ludwig Tieck und E.T.A. Hoffmann.
Die Romantik-Epoche: Gegenbewegung zur Aufklärung
Um das Denken der Romantiker*innen zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf die Vorgängerpoche werfen: die Aufklärung (1720 – 1800). Aus heutiger Sicht wird die Epoche sehr positiv gewertet, weil sie, so pathetisch es auch klingen mag, den Aufbruch in eine neue Zeit bedeutet. Es entwickelte sich ein bürgerliches Bewusstsein, das nach Freiheit und Vernunft strebte und die bestehenden Herrschaftsstrukturen hinterfragte – und das auf gesellschaftlicher, politischer und religiöser Ebene. Ihr Streben nach “Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit” gipfelte 1789 in der Französischen Revolution. Diese Forderung ist auch in unserer heutigen Welt immer noch aktuell.
Die Vertreter*innen der Romantik lehnten die Ideale der Aufklärung jedoch ab. Als Gegenbewegung zur Aufklärung wollten sie in einer von Vernunft und Wissenschaft geprägten, immer technischer werdenden Welt das Mystische und Geheimnisvolle bewahren. Sie wollten eben nicht alles erklären, empfanden ihre Umwelt als feindselig und verabscheuten die lauten und schmutzigen Städte.
Veränderungen der Zeit
Wie alle Literaturepochen so ist die Romantik damit ebenfalls eine Reaktion auf die politischen Turbulenzen und gesellschaftlichen Umbrüche ihrer Zeit. Und davon gab es einige:
- die Französische Revolution (1789)
- die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (1806)
- die Befreiungskriege (1813 – 1815)
- der Wiener Kongress(1814 – 1815)
- die Industrialisierung
Insgesamt war die Romantik also eine turbulente Zeit mit tiefgreifenden Veränderungen. Daraus ergibt sich ein bestimmter Blick auf die Welt, der sich in spezifischen Merkmalen und Motiven äußerte, die als typisch für die Romantik gelten.
Themen und Merkmale der Romantik
Jede Literaturepoche hat bestimmte Themen, die ihre Literatur verarbeitet, und Merkmale, die sich auf die Gestaltung der Literatur auswirken. In der Romantik waren das:
| Merkmal | Bedeutung |
| Weltflucht | Ablehnung der Entwicklungen der Zeit, Flucht in Traum- und Melancholiewelten. |
| Hinwendung zur Natur | Idealisierung der Natur als Ort, an dem die Sehnsucht nach dem Schönen und geheimnisvollen Erfüllung findet. |
| Betonung des Individuums | subjektive Gefühle stehen, anders als in der Aufklärung, über dem Verstand. |
| Verklärung des Mittelalters | Reaktion auf die Weimarer Klassik, die sich, um die enttäuschten ideale der Aufklärung zu verarbeiten, der antiken Sagenwelt und ihren Helden zuwandte. Die Romantik besann sich aufs Mittelalter und verherrlichte, romantisierte es. Die Missstände dieser Zeit ließ sie außer Acht. |
Typische Motive der Romantik-Epoche
In der Literatur der Romantik tauchen bestimmte Motive, die die Themen der Epoche verbildlichen, immer wieder auf. Einige davon finden wir auch im Märchen wieder.
Die blaue Blume
Im Märchen eher nicht vertreten, dennoch das zentrale Motiv der Romantik: die blaue Blume. Sie steht für alles, was der Romantik wichtig war: Natur, Mensch und Geist sowie das Streben nach der Erkenntnis der Natur und des Selbst.
Das Nachtmotiv
Die Nacht als Schauplatz des Unheimlichen und Mystischen ist ebenfalls ein charakteristisches Motiv der Romantik, das in vielen literarischen Werken dieser Zeit verarbeitet wurde. Damit in Verbindung sind typisch „romantische“ Orte wie Friedhöfe, Ruinen, dunkle Wälder (die uns ja sehr häufig in Märchen begegnen), Moore, Nebellandschaften und Höhlen – also alles, was schaurig-schön und geheimnisvoll ist.
Das Spiegelmotiv
Dieses Motiv schreit nach Märchen: das Spiegelmotiv. Wir kennen es zum Beispiel aus Schneewittchen (das wir ausführlich schon in unserer Folge 9 „Ricottakäse und Disneyzauber“ behandelt sowie in Folge 8 als Hörspiel eingelesen haben). Der Spiegel steht für die Hinwendung zum Unheimlichen und Übernatürlichen und ist die Schnittstelle zwischen Realem und Irrealem. Außerdem rückt er das Ich in den Fokus und steht für die Ich-Bezogenheit dieser Zeit.
Ziel der Romantik
Was wollte die Romantik also? Zum einen wollte sie sich von den Idealen der Aufklärung und der Weimarer Klassik abgrenzen und das Schöne und Geheimnisvolle in der Welt ebenso bewahren wie die nationalen Geschichten. Zum anderen wollte sie einer vernunftgesteuerten, immer technischeren Welt entfliehen, in der die Schönheit und das Unerklärliche mehr und mehr verloren gingen. Oder drücken wir es anders aus, mit den Worten von Novalis:
Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder.
Novalis
Die Literatur der Romantik
Die Literatur der Romantik-Epoche unterscheidet sich in einem ganz wesentlichen Merkmal von ihren Vorgängerepochen: Sie war an keine klaren Vorgaben gebunden. Anders noch als die einem strikten Schema folgende Literatur des Barock (1600–1750) behandelt die romantische Literatur zwar bestimmte Themen und Motive, ist dabei jedoch an kein festes Schema gebunden. Das zeigt sich auch im Konzept der progressiven Universalpoesie.
Laut Friedrich Schlegel will und soll die progressive Universalpoesie „auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen.“ Es geht also darum, die drei literarischen Gattungen Epik, Dramatik und Lyrik zusammenzuführen und die Grenzen zwischen diesen Textgattungen zu sprengen. Anders ausgedrückt: Die Vorgaben, die für ein literarisches Werk bisher galten, sollten den Künstler oder die Künstlerin als freischaffendes Genie in seiner oder ihrer fantasievollen Schaffenskraft nicht länger einschränken. Außerdem sollte die Universalpoesie eine Verbindung zwischen Literatur und Kunst und Wissenschaft schaffen und das auf eine fortschrittliche, erweiterbare und niemals abgeschlossene Weise. Diese Idee führte dazu, dass die Poesie der Romantik häufig unvollendet und das Fragment eine wichtige Textart dieser Literaturepoche ist.
Die Lyrik in der Romantik
Beim Stichwort „Poesie“ werfen wir zunächst einen Blick auf die literarische Gattung der Lyrik. Sie war bei den Vertretern und Vertreterinnen der Romantik besonders beliebt, da sie sich am besten dafür eignet, der inneren Gefühlswelt mit vielen sprachlichen Bildern, Symbolen und Sinneseindrücken Ausdruck zu verleihen – genau das war den Romentikern und Romantikerinnen ja besonders wichtig.
Aufgebaut wie ein Volkslied – ein ebenso wichtiger Aspekt in der Romantik – bestehen romantische Gedichte oft aus Strophen mit vier bis sechs Versen, die als Reimschema einen Kreuzreim aufweisen. Im Sinne der Universalpoesie arbeiteten die Autoren und Autorinnen in ihre lyrischen Werke außerdem epische, also erzählerische Elemente mit ein, um so die Grenzen zwischen den literarischen Gattungen zu sprengen.
Die Dramatik in der Romantik
Anders als Lyrik und Epik spielte die Dramatik in der Romantik eine eher untergeordnete Rolle. Grund dafür ist die Tetxtgattung selbst: Das Drama folgt einem klaren Aufbau, einem Schema und damit genau dem, was die Vertreter und Vertreterinnen dieser Epoche nicht wollten. Sie sahen darin das Konzept der Universalpoesie blockiert, zudem ließen sich fantastische oder unheimliche Elemente besser in lyrischen oder epischen Texten darstellen.
Dennoch entstanden auch zur Zeit der Romantik einige Dramen. Sich gar nicht mit dieser Textgattung zu beschäftigen, hätte dem Prinzip der progressiven Universalpoesie ja auch widersprochen. Das bekannteste Drama ist die märchenhafte Komödie Der gestiefelte Kater von Ludwig Tieck aus dem Jahr 1797.
Die Epik in der Romantik
Für die Auseinandersetzung mit Märchen ist insbesondere die Textgattung der Epik relevant. Unter den epischen Literaturformen waren zur Zeit der Romantik vor allem die Novelle und eben das Märchen verbreitet. Ausgehend vom Volksmärchen mit seiner mündlichen Erzähltradition entwickelte sich das Kunstmärchen als literarische Textsorte.
Darüber hinaus waren bei den Autorinnen und Autoren Volksmärchen, Lieder und Briefe beliebt. Eine besondere Rolle nahm der Roman ein. Und mit Metzengerstein im Jahr 1832 schuf der amerikanische Schriftsteller Edgar Allen Poe sogar eine neue Textform: die Kurzgeschichte.
Romantische Märchen
Es ist selbsterklärend, dass die Romantik natürlich auch Einfluss auf die Grimms und damit auf die Märchen hatte, die sie niederschrieben. Viele Gemeinsamkeiten habt ihr beim Lesen wahrscheinlich schon erkannt. Die Einflüsse der Romantik sind in den Grimm-Märchen sehr deutlich erkennbar:
-
- Märchen sind ein Kontrast zu einer immer technisierteren, rational geprägten Welt: Eine solche Welt lehnten die Romantiker*innen ab.
- Märchen romantisieren die Welt und bewahren das Gute und Schöne.
- Nationaler Gedanke: Bewahrung der eigenen Kultur durch Märchen.
- Neuschöpfung des Kunstmärchens: Die Natur ist hier nicht mehr nur Kulisse wie im Volksmärchen, sondern ein eigenes Ausdruckselement.
- Das Schaurig-Schöne: Märchen haben gruselige, unheimliche Elemente.
Mit diesen Hintergründen seht ihr die Grimm-Märchen künftig vielleicht mit anderen Augen. Und ihr seht, dass Märchen historische Zeugnisse sind, die uns trotz ihrer scheinbaren Einfachheit unglaublich viel über die Zeit, in der sie entstanden sind, erzählen. Damit sind sie nicht bloß eine Geschichte, sondern auch eine Geschichte über die Geschichte.
Die Romantik im Überblick
-
- Zeitraum: 1795–1835
- Einordnung: Gegenbewegung zu Aufklärung und Weimarer Klassik
- bedeutende Ereignisse: Industrialisierung, Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Sieg über Napoleon und Wiener Kongress
- Merkmale: Weltflucht, Hinwendung zur Natur, Rückzug in Fantasie- und Traumwelten, Melancholie
- Motive: die Blaue Blume, Spiegel- und Nachtmotiv
- Literatur: vor allem Lyrik, aber auch Märchen und Novellen
- Vertreter /-innen: Joseph von Eichendorff, E.T.A. Hoffmann, Bettina von Armin, die Brüder Grimm