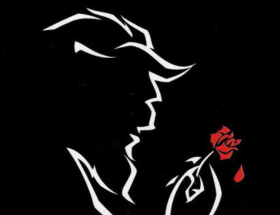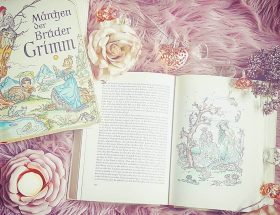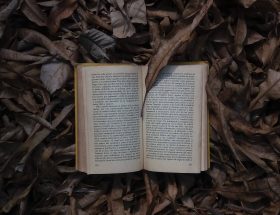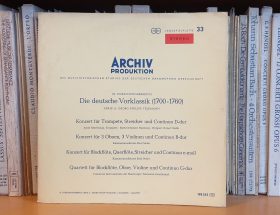Die Literaturepoche des Barock ist geprägt von starken Gegensätzen: Überschwänglicher Lebensfreunde tritt innbrünstige Todessehnsucht gegenüber. Warum das nur ein scheinbarer Widerspruch ist und was es sonst über die Barock-Epoche zu wissen gibt, lest ihr hier.
Die Barock-Epoche: ein Spiegel ihrer Zeit
Die Epoche des Barock nimmt eine wichtige Stellung in der europäischen Literaturgeschichte ein. Sie ist eine der bedeutendsten Epochen der frühen Neuzeit, die nicht nur die geistigen, politischen und sozialen Spannungen ihrer Zeit widerspiegelt, sondern auch neue Ausdrucksformen und eine intensive Auseinandersetzung mit den zentralen Fragen des menschlichen Daseins entwickelte. Da sie zeitlich aber noch vor der Aufklärung liegt, zeigt sie uns zudem viel über das voraufklärerische Welt- und Menschenbild.
Als Zeugin des größten und prägendsten Ereignisses ihrer Zeit, dem Dreißigjährigen Krieg, führt uns die Barock-Epoche außerdem vor Augen, wie stark Literatur von ihrem zeitgeschichtlichen Kontext abhängt. In der barocken Literatur spiegeln sich die turbulenten Umbrüche und tiefen Krisen der Zeit wider, die durch Krieg, Religion und politische Instabilität gekennzeichnet waren. In welchen Merkmalen und Motiven sich äußerst, wie die Menschen damals dachten und welche Bedeutung der Barock in der Literaturgeschichte hat, erfahrt ihr hier.
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.
Andreas Gryphius, 1616 – 1664
Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein
Definition: Das ist der Barock
Die deutsche Literaturepoche des Barock umfasst den Zeitraum von circa 1600 bis 1750 und folgt damit auf die Epochen der Renaissance und des Humanismus. Ihre Bezeichnung “Barock” leitet sich vom portugiesischen „barroco“ ab, was „seltsam geformte Perle“ bedeutet und ursprünglich abwertend verwendet wurde. Denn aus der Sicht der Moderne, die eine völlig gegensätzliche, da schlichtere und geradlinigere Ästhetik entwickelte, war der Barock schwülstig und überfrachtet. Auch heute noch wird er gerne mit Kitsch gleichgesetzt – oft fällt in diesem Zusammenhang auch mal der Begriff “Gelsenkirchener Barock”. Das ist eine ironische Bezeichnung, die sich auf sperrige, wuchtige und altmodische Möbelstücke bezieht, die heute eben als kitschig gelten.
Da Literaturepochen ihren Namen immer erst im Nachhinein erhalten, wurde hier ein Begriff gewählt, der auf die Übertreibung und ausladende Ornamentik dieser Zeit anspielt. Insgesamt ist die Barock-Epoche von Überschwang, Pomp und starken Gegensätzen geprägt. Was das genau bedeutet, schauen wir uns jetzt näher an.
Der historische Hintergrund
Um die Merkmale des Barock und das dahinter stehende Welt- und Menschenbild zu verstehen, müssen wir uns zunächst den historischen Hintergrund ansehen. Wie bereits erwähnt ist dieser prägend für alle Literaturepochen, der Barock macht die Abhängigkeit der Literatur von ihrem zeitgeschichtlichen Kontext aber besonders deutlich. Denn der Barock musste sich mit einem traumatischen Großereignis und seinen verheerenden Folgen auseinandersetzen: dem Dreißigjährigen Krieg.
Der Dreißigjährige Krieg
Von 1618 bis 1648 wütete in Europa der Dreißigjährige Krieg. Ursprünglich war das ein Religionskrieg zwischen der Katholischen Liga und der Protestantischen Union, dessen Ausgangspunkt die im Jahre 1517 beginnende Reformation und die damit einhergehende Abspaltung der Protestantischen von der Katholischen Kirche war. Er führte zur konfessionellen Spaltung Deutschlands und Europas.
Zeitgleich entluden sich in dem Krieg auch machtpolitische Konflikte, die größtenteils auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation ausgetragen wurden.
Die Folgen des Krieges
Infolge des Krieges schrumpfte die deutsche Bevölkerung um ein Drittel. Und das hatte sichtbare Folgen: Regionen verödeten und die bäuerliche Bevölkerung starb praktisch aus. Der Krieg war allgegenwärtig, es gab eine ganze Generation, die nur Krieg und keinen Frieden kannte.
Neben den enormen Verlusten an Menschenleben, führte die Verarmung zu Unsicherheit und Existenzängsten. Demgegenüber stand der monarchische Absolutismus, der mit überbordender Zierart seine Blütezeit erlebte und seine Macht mit Pomp und Überfluss zur Schau stellte.
Die Rolle der Religion
Religion war zu dieser Zeit tief in der Gesellschaft verankert, die Reformation änderte aber vieles. Die Konfrontation zwischen katholischer und protestantischer Kirche führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Glauben, der Sünde und der Errettung. Und so zeigt sich im Barock ein starkes Bewusstsein für die Vergänglichkeit des Lebens und die Nähe zum Tod.
Merkmale der Barockliteratur
Wie in allen Literaturepochen so ist auch für die Barock-Epoche der zeitgeschichtliche Kontext für die Ausprägung der charakteristishen Merkmale dieser Epoche verantwortlich. Zu den typischen Merkmalen des Barock gehören die Antithetik, Vergänglichkeit und Tod, Glaube und Religion sowie Prunk und die Ständegesellschaft.
Antithetik
Die Erfahrungen und täglichen Konfrontation mit einem scheinbar nie enden wollenden Krieg und dessen Folgen spiegeln sich in einem sehr gegensätzlichen, sprich antithetischen Weltbild wider. In ihm spiegeln sich zum einen die Gefühle der Bevölkerung wider, zum anderen entspricht die Antithetik der damaligen Lebenswirklichkeit: Während an den Fürstenhöfen nach dem Vorbild des französischen Absolutismus Luxus und Verschwendungssucht herrschten, war das Leben der einfachen Bevölkerung geprägt von bitterer Armut, Hunger und Pessimismus. Prunkvolle Bauten demonstrieren die Macht des Adels, gleichzeitig waren ganze Landstriche ausgestorben. Dem Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit trat der Drang nach Sinnes- und Lebensfreude gegenüber.
Häufige Gegensätze wie Leben und Tod, Diesseits und Jenseits, Freude und Leid dominieren die Barockliteratur. Diese Polaritäten spiegeln die zerrissene Weltanschauung der Zeit wider. Typische barocke Antithesen sind:
- Diesseits und Jenseits
- irdisches und himmlisches Leben
- Tugend und Wollust
- Erotik und Askese
- Spiel und Ernst
- Schein und Sein
Vergänglichkeit und Tod
Die Allgegenwärtigkeit des Todes und die Unsicherheit des Lebens ist eines der dominierenden Themen der Barock-Epoche. Viele barocke Werke enthalten die Mahnung, dass alles Irdische vergänglich und der Tod unausweichlich, vielleicht sogar erstrebenswert ist.
Glaube und Religion
Der barocke Mensch war oft tief religiös und suchte in der Literatur Antworten auf die existenziellen Fragen des Glaubens. So finden sich in der Barockliteratur häufig Auseinandersetzungen mit der Frage nach Erlösung und Sünde.
Prunk und Zierart
Ihr kennt es wahrscheinlich von barocken Schlössern oder der ausladenden barocken Mode: Der Barock war eine Zeit des Überflusses und des Pomp. Mehr ist mehr war das Motto, das sich auch in der Literatur widerspiegelt. Der ästhetische Luxus findet sich hier in Form einer reichen und kunstvollen Sprache wieder.
Ständeordnung
In der Barockzeit ist die Literatur stark von der Gesellschaftsordnung und dem politischen System des Absolutismus beeinflusst. Die Autoren legitimierten oft die Herrschaft der Monarchen oder kommentierten die gesellschaftlichen und religiösen Umstände.
Motive des Barock
Die Literatur des Barock ist von drei zentralen Motiven geprägt: Vanitas, Memento mori und Carpe diem. Sie beschreiben das Lebensgefühl der Menschen und setzen sich mit der Angst und der Bedrohung vor und durch den Krieg auseinander.
Das Vanitas-Motiv
Der lateinische Begriff “Vanitas” bedeutet „Vergänglichkeit“, „Nichtigkeit“, „Eitelkeit“ oder „Misserfolg“ und stellt die Vergänglichkeit und Bedeutungslosigkeit des Menschen und des eigenen Lebens in den Vordergrund. Darin liegt auch ein religiöser Aspekt: Das irdische Leben ist vergänglich, gemäß dem christlichen Glauben wartet dafür ein besseres Leben im Jenseits.
Memento mori
„Bedenke, dass du sterben musst“ – das Memento-mori-Motiv rückt ebenfalls das Thema Tod und Vergänglichkeit in den Mittelpunkt. Es erinnert daran, dass jeder und jede sterben muss – angesichts des anhaltenden Krieges wurde der Tod als allgegenwärtig und unausweichlich wahrgenommen.
Carpe diem
Der Gedanke an den allgegenwärtigen Tod steht im Gegensatz zur Idee des Carpe diem, das daran appelliert, den Tag zu nutzen. Es bedeutet „Nutze den Tag“ und stellt, gemäß dem antithetischen Weltbild des Barock, dem Tod das Leben gegenüber. Carpe diem ruft dazu auf, bewusst zu leben, den Tag zu genießen und den Gedanken an die eigene Vergänglichkeit nicht zu schwer zu nehmen.
| Motiv | Bedeutung |
| Vanitas-Motiv | Alles ist vergänglich. |
| Memento mori | „Bedenke, dass du sterben musst.“ |
| Carpe diem | „Nutze den Tag.“ |
Die Barockliteratur
In der Barockliteratur dominiert eine literarische Gattung: die Lyrik. Gedichte waren die bevorzugte Literaturform dieser Epoche – und die Gründe dafür liegen auf der Hand: Wenn wir uns den Hang des Barock zu Überfluss und Überschwang bewusst machen, ist die Lyrik dafür am besten dafür geeignet, diese zum Ausdruck zu bringen.
Die Barocklyrik ist durch ihre formale Strenge und ihre emotionale Intensität geprägt. Die beliebteste barocke Gedichtform war das Sonett, aber auch Elegie, Epigramm und Ode gehören zu den vorherrschenden Gedichtformen der Barock-Epoche.
Sonett
Das Sonett war die Gedichtform, die unter den barocken Autoren besonders beliebt war. In ihm spiegelt sich auch die Formstrenge der Barocklyrik wider, denn das Sonett hat eine festen, unveränderbaren Aufbau: Es besteht aus vierzehn Versen, die sich auf vier Strophen verteilen. Auf zwei Quartette folgen zwei Terzette. Als Metrum, also Versmaß, das den Rhythmus des Gedichtes festlegt, ist ein sechshebiger Jambus üblich, der sogenannte Alexandriner.
Elegie
Auch die Elegie hat eine festgelegte Form: Sie besteht nur aus Distichen, also Zweizeilern. Diese Zweizeiler setzen sich in der Regel aus Daktylen zusammen. Der Daktylus ist ein Versmaß, das durch die Silbenfolge betont, unbetont, unbetont gekennzeichnet ist. Die Grundstimmung der Elegie ist wehmütig und resignierend.
Epigramm
Das Epigramm ist ein kurzes Sinn- oder Spottgedicht, das in geraffter, zugespitzter Form unterschiedlichste Gedanken ausdrücken kann. Folglich ist es sehr kurz und pointiert. Häufig sind Epigramme antithetisch aufgebaut: Der erste Vers stellt eine Behauptung auf, die in den nachfolgenden verneint wird.
Ode
Die Ode ist eine Gedichtform mit einem besonders feierlichen und erhabenen Stil. Das liegt daran, dass sie ihren Ursprung im antiken Chorgesang hat und zu einer Melodie gesungen wurde.
Strömungen der Barocklyrik
Insgesamt kann die Barocklyrik in verschiedene Strömungen unterteilt werden:
- Ästhetische Lyrik: Hier stehen das Spielen mit Sprache, der Glanz und die Schönheit der Ausdrucksweise im Vordergrund.
- Reflexive Lyrik: Diese Lyrik ist von einer intellektuellen Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen, dem Glauben und der Bedeutung des Lebens geprägt.
- Religiöse Lyrik: Die barocke Lyrik enthält viele religiöse Gedichte, die den Glauben an Gott, die Angst vor der Hölle oder die Hoffnung auf das ewige Leben thematisieren.
Wichtige Werke und Autoren
Zu den bedeutendsten Barocklyrikern zählt Andreas Gryphius (1616 – 1664). Sein Sonett Es ist alles eitel gehört zu den bekanntesten Gedichten dieser Zeit.
| Autor | lebte von | berühmte Werke |
| Andreas Gryphius | 1616 – 1664 | Es ist alles eitel, |
| Martin Opitz | 1597 – 1639 | Carpe diem |
| Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau | 1616 – 1679 | Vergänglichkeit der Schönheit |
Weitere barocke Literaturformen
Auch wenn die Lyrik in der Barock-Epoche die beliebteste literarische Ausdrucksform war, wurden auch Prosa-, also erzählende Texte verfasst, etwa Romane, Schwänke, Satire oder Sprüche. Das bekannteste Werk ist hier der Schelmenroman „Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch“ von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen aus dem Jahr 1668. Er gilt als der erste Abenteuerroman.
Ansonsten gab es im Barock viel nicht-fiktionale Literatur: Reisebeschreibungen, Predigten und journalistische wie wissenschaftliche Werke.Theaterdichtung, also Texte aus der literarischen Gattung der Dramatik, gab es im deutschsprachigen Raum hingegen kaum. Stattdessen waren die Tragödien und Komödien von Shakespeare und Molière beliebt.
Die Sprache des Barock
Die barocke Sprache ist eine der kunstvollsten und formal strengsten der Literaturgeschichte. Sie zeichnet sich durch eine Vielzahl rhetorischer Mittel aus, die das Ziel verfolgen, die Lesenden oder die Hörenden zu beeindrucken und tief zu bewegen. Aus diesem Grund kommen in Barockgedichten zahlreiche rhetorische Mittel vor, die eine starke Bildsprache haben:
- Metaphern und Allegorien: Bildhafte Darstellungen und symbolische Sprache sind zentrale Stilmittel der barocken Dichtung. Sie sollen tiefere Wahrheiten über das Leben und das Jenseits vermitteln.
- Antithesen: Die Gegenüberstellung von Gegensätzen wie „Leben“ und „Tod“ oder „Freiheit“ und „Fesseln“ dient dazu, die Ambivalenz und die Spannung der barocken Weltanschauung darzustellen.
- Paradoxa: Häufig sind auch Widersprüche oder scheinbar widersprüchliche Aussagen zu finden, die eine tiefere Wahrheit ausdrücken.
- Hochgestochene, oft ornamentale Sprache: Die Dichter verwendeten eine sehr kunstvolle Sprache, die sich durch eine Vielzahl an Adjektiven und stilistischen Verzierungen auszeichnet.
Mit der bildhaften, anspruchsvollen Sprache ist es wie mit barocken Prachtbauten oder den ausladenden Kleidern der adeligen Frauen: Sie ist so üppig und ausdrucksstark, dass sie euch beeindrucken soll.
Gattungen
Generell folgten die barocken Literaten einem klar festgelegten Muster. So war die Sprache der Dichtung in drei Gattungen unterteilt, die ebenfalls wieder einen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Menschen darstellen. Denn die drei Gattungen spiegeln die Ständegesellschaft – Adel, Bürgertum und Bauern – wider:
- Gattung: Hoher Stil = würdevolle Sprache
- Gattung: Mittlerer Stil = normale Sprache
- Gattung: Niederer Stil = einfache Sprache
Im Barock war kein Platz für Experimente. Die Vorgaben mussten eingehalten werden. Im Gegensatz zu vielen anderen, späteren Epochen wie der Romantik (1795 –1848) oder dem Expressionismus (1905 – 19256) , ging es nicht darum, etwas Neues zu kreiieren, sondern den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu geben, sich selbst und ihre eigenen Erfahrungen in den Werken wiederzufinden. Das wurde durch eine wichtige Neuerung erleichtert: Erstmals wurden Texte nicht mehr in Latein, sondern in deutscher Sprache verfasst. Die barocken Dichter sind somit maßgeblich für die Entwicklung und Entfaltung der neuhochdeutschen Literatur verantwortlich.
Die Bedeutung des Barock
Wie ihr sehen könnt, ist die barocke Literatur durch eine komplexe Wechselwirkung von religiösen, politischen und kulturellen Faktoren geprägt. Sie spiegelt die Zerrissenheit und Unsicherheit der Epoche wider und thematisiert zentrale Fragen des Lebens, des Todes und des Glaubens. Ihre oft zu unrecht als altmodisch, überladen und schwer verständlich abgetane Sprache zeichnet sich durch eine große rhetorische Raffinesse, eine gewaltige Bildsprache und starken emotionalen Ausdruck aus, denen eine hohe sprachliche Kunstfertigkeit zugrunde liegt.
Trotz ihrer Formstrenge hat der Barock die literarischen Ausdrucksformen weiterentwickelt. Besonders das Sonett, das von Petrarca in der italienischen Renaissance eingeführt wurde, erlebte im Barock eine Renaissance und wurde von Dichtern wie Opitz und Gryphius perfektioniert. Darüber hinaus war die brocke Literatur Teil eines umfassenderen kulturellen Phänomens, das auch die bildende Kunst, Architektur und Musik umfasste. Der barocke Prunk, die Üppigkeit und die Überwältigung durch Kunst und Schönheit fanden ihren Widerhall in der Literatur. Die barocke Ästhetik beeinflusste spätere Epochen der europäischen Kultur und setzte Maßstäbe für das Verhältnis zwischen Kunst, Gesellschaft und Religion. Das alles macht den Barock zu einer bedeutenden Epoche der Literaturgeschichte.
Die Barock-Epoche im Überblick
- Zeitraum: 1600–1750
- Einordnung: folgt auf Renaissance und Humanismus
- bedeutende Ereignisse: der Dreißigjährige Krieg
- Weltbild: antithetisch
- Themen: Diesseits und Jenseits, irdisches und himmlisches Leben, Tugend und Wollust, Todessehnsucht und Lebensfreude
- Motive: Vanitas, Memento mori, Carpe diem
- Literatur: Lyrik (Sonett, Epigramm, Elegie und Ode)
- Vertreter: Andreas Gryphius, Martin Opitz, Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau