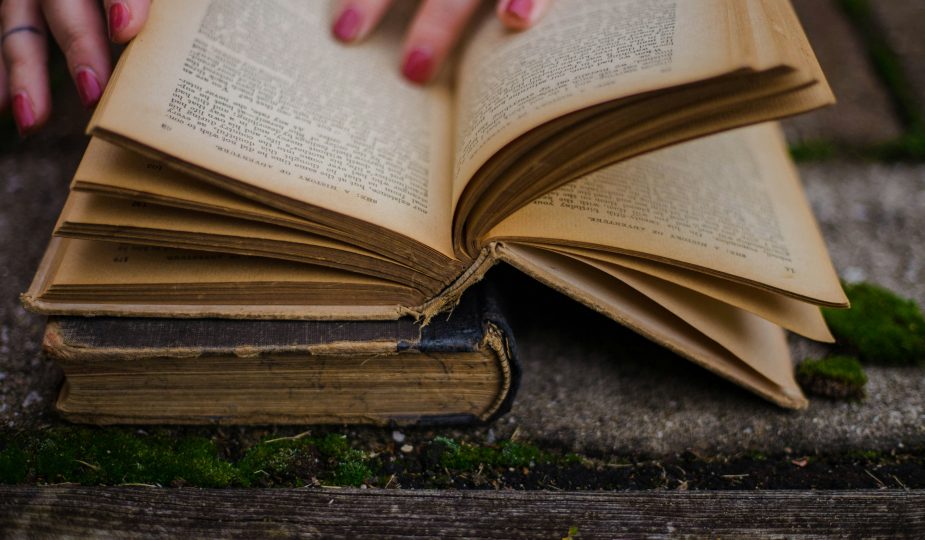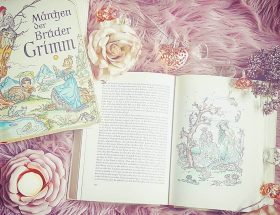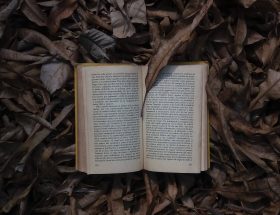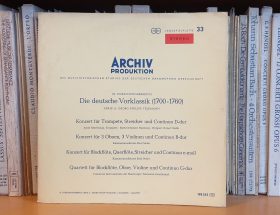Das Erzählverhalten ist ein wichtiges Merkmal epischer Texte. Hier erklären wir euch, was das Erzählverhalten ist, welche verschiedenen Perspektiven ein Erzähler einnehmen kann und welche Funktion das Ganze hat.
Das Erzählverhalten: großer Einfluss
Manche Geschichten gehen uns sehr nahe, andere betrachten wir eher distanziert und in manchen Geschichten tut eine Figur Dinge, die wir unmöglich finden, aber trotzdem nachvollziehen können. Die Art, wie wir eine Geschichte wahrnehmen, hat nicht nur etwas mit dem Inhalt zu tun. Sie ist vor allem vom Erzählverhalten bestimmt, das einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Wirkung einer Geschichte hat. Warum das so ist und was das genau bedeutet, erfahrt ihr hier.
Definition: Was ist das Erzählverhalten?
Das Erzählverhalten beschreibt die Haltung und Perspektive, aus der eine Geschichte erzählt wird. Sie ist an den Erzähler gekoppelt. Das ist derjenige, der durch die Geschichte führt. Wichtig an dieser Stelle: Der Erzähler eines literarischen Textes ist nicht gleichzusetzen mit dem Autor oder der Autorin. Vielmehr wird er bewusst vom Verfasser oder der Verfasserin eingesetzt, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen und die Geschichte auf eine bestimmte Art zu erzählen. Ihr könnt ihn euch also wie eine eigene Figur vorstellen, die Autor*innen kreieren, um ihre Geschichte zu erzählen.
Durch seine Art zu erzählen, sprich sein Erzählverhalten, beeinflusst der Erzähler maßgeblich, wie wir als Leser*innen Informationen über Figuren, Handlung und Gedanken erhalten und wahrnehmen. Das wiederum hat entscheidenden Einfluss darauf, wie wir die Figuren und die Geschichte erleben. Das Erzählverhalten hängt eng mit der Erzählperspektive zusammen und bestimmt, wie viel Nähe oder Distanz zwischen Erzähler und Geschehen entsteht.
Wichtig: Erzähler ungleich Autor*in
Übrigens: Das Erzählverhalten ist ein Merkmal, das es nur in der literarischen Gattung der Epik gibt. Das bedeutet, dass der Erzähler nur in erzählenden Texten wie Romanen, Kurzgeschichten, Fabeln oder Märchen vorkommt. Jeder epische Text hat einen Erzähler.
Unterschied zur Erzählperspektive
Als Synonym zum Erzählverhalten wird oft der Begriff “Erzählperspektive” verwendet. Tatsächlich hängen beide eng zusammen, es gibt aber einen Unterschied: Das Erzählverhalten bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Handlung einer Geschichte präsentiert wird.
Die Erzählperspektive bezieht sich auf den Standpunkt oder Blickwinkel, aus dem die Geschichte erzählt wird. Sie beschreibt also, wer die Geschichte erzählt.
| Begriff | Definition | Beispielhafte Frage |
| Erzählverhalten | bezieht sich auf den Standort bzw. Blickwinkel, aus dem das Geschehen erzählt wird | Wer sieht das Geschehen? |
| Erzählperspektive | bezieht sich auf die Haltung des Erzählers zur Geschichte, z. B. allwissend, personal oder neutral. | Wie verhält sich der Erzähler zur Handlung? |
Nachdem wir im Folgenden die verschiedenen Arten des Erzählverhaltens geklärt haben, kommen wir auf diese Unterscheidung noch einmal genauer zurück.
Dieses Erzählverhalten gibt es
In der Literatur unterscheidet man grundsätzlich drei Arten des Erzählverhaltens: auktorial, personal und neutral. Sie alle haben ihre ganz eigene Art, die Leserschaft durch die Geschichte zu führen und sind durch charakteristische Merkmale, ihre ganz eigene Funktion sowie ihren Einfluss auf die Wirkung des Textes gekennzeichnet.
Das auktoriale Erzählverhalten
Der auktoriale Erzähler wird auch als allwissender Erzähler bezeichnet, weil er wirklich alles weiß. Er ist nicht auf die Wahrnehmung einer Figur beschränkt, sondern kennt alle Gedanken, Gefühle und Zusammenhänge. Er kann Aussagen über Vergangenheit oder Zukunft treffen und die Handlung kommentieren. Dadurch hat er gegenüber den Figuren einen Wissensvorsprung, den er gezielt einsetzen kann, um die Leserschaft daran teilhaben zu lassen, zum Beispiel: Hätten sie geahnt, dass dies ihre letzte Begegnung sein würde, wären sie vielleicht nicht im Streit auseinandergegangen.
Da der auktoriale Erzähler außerhalb der Handlung steht und mehr weiß als alle anderen, tritt er meist sehr deutlich in Erscheinung. Darüber hinaus kann er die Leser*innen auch direkt ansprechen oder sich in Form von Kommentaren in das Geschehen einmischen, zum Beispiel: Aber wir alle wissen ja, dass das keine gute Idee war.
Merkmale des auktorialen Erzählers
- Der auktoriale Erzähler wird auch als allwissender Erzähler bezeichnet, weil er alles weiß.
- Er kennt die Gedanken und Gefühle aller auftretenden Figuren.
- Er kann Handlungen kommentieren, beurteilen und reflektieren sowie auf Vergangenheit und Zukunft verweisen.
- Er weiß mehr als Figuren und Leser /-innen.
- Er kann die Leser /-innen direkt ansprechen.
Formal verwendet der auktoriale Erzähler die Personalpronomen der 3. Person, also er und sie.
Funktion des auktorialen Erzählers
Der auktoriale Erzähler vermittelt umfassende Informationen und schafft eine Distanz zur Handlung, gleichzeitig kann er durch Kommentare die Lesersicht beeinflussen. Er leitet uns Leser*innen durch die Geschichte und kann durch Bewertungen und Kommentare beeinflussen, wie wir die Geschichte wahrnehmen.
Dadurch kann er uns einen umfassenden Überblick geben, Spannung aufbauen oder uns auf eine falsche Fährte führen.
Das personale Erzählverhalten
Anders als der allwissende Erzähler ist das personale Erzählverhalten an die Wahrnehmung und das Wissen einer bestimmten Person gebunden. Die Geschichte wird aus der Sicht einer oder mehrerer Figuren erzählt. Der Erzähler nimmt die Perspektive einer Figur ein, ohne dabei allwissend zu sein. Die Leser*innen erleben die Handlung „von innen“, mit einem subjektiven Blick.
Das personale Erzählverhalten ist nicht an eine Figur gebunden, die Person, aus deren Sicht die Geschichte erzählt wird, kann im Laufe der Geschichte auch wechseln. In diesem Fall spricht man dann von einer Multiperspektive. Allerdings kann der personale Erzähler nie gleichzeitig aus der Sicht von zwei Figuren erzählen.
Beispiele für personales Erzählverhalten
Ein sehr anschauliches Beispiel für den Einsatz eines personalen Erzählverhaltens ist die literarische Vorlage der High-Fantasy-Serie Game of Thrones „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R.R. Martin. Martin erzählt sein Fantasy-Epos durchgehend aus der Sicht eines personalen Erzählers. Dieser wechselt jedoch kapitelweise, sodass wor Leser*innen ein und dasselbe Ereignis aus ganz verschiedenen Sichtweisen erleben. So gelingt ihm nicht nur eine detaillierte Charakterisierung seiner Figuren. Auch die Grenze zwischen Richtig und Falsch sowie Gut und Böse verwischt dadurch.
Ein weiteres Beispiel für ein personales Erzählverhalten finden wir in folgenden Literaturklassikern:
| Titel | Autor | Erzählverhalten |
| Der Prozess | Franz Kafka | Die Handlung wird aus der Sicht von Josef K. erzählt – subjektiv und begrenzt. |
| Effi Briest | Theodor Fontane | Der Erzähler ist auf Effis Erleben konzentriert – ihr Innenleben steht im Fokus. |
| Die Verwandlung | Franz Kafka | Erzählt aus der Perspektive von Gregor Samsa und vermittelt seine Gedanken und Ängste. |
| Die Leiden des jungen Werther | Johann Wolfgang von Goethe | In Briefform verfasst – eine besondere Form der personalen Perspektive, sehr subjektiv. |
Merkmale eines personalen Erzählers
Der personale Erzähler kann zwei verschiedene Perspektiven einnehmen: die Er/Sie-Perspektive oder die Ich-Perspektive. Anders als beim auktorialen Erzähler gibt es beim personalen Erzähler keine Kommentare oder andere Formen der Kommunikation mit dem/der Leser /-in.
- Der personale Erzähler erzählt aus der Perspektive einer Person. Du kennst nur deren Gefühle und Gedanken.
- Die Person, deren Perspektive er einnimmt, kann wechseln. Er kann aber nie aus der Sicht zweier Personen gleichzeitig erzählen.
- Du unterscheidest zwischen personalem Er/Sie- und Ich-Erzähler.
- Die Sicht eines personalen Erzählers ist immer eingeschränkt.
- Es gibt keine Kommentare oder Kommunikation mit den Lesern /-innen.
Funktion des personalen Erzählverhaltens
Das personale Erzählverhalten vermittelt die Innensicht einer Figur. Wir als Leser*innen lernen ihre Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen kennen, was eine hohe Nähe zwischen uns und der Figur erzeugt. Wir können an ihrem Innenleben teilhaben und bekommen so die Möglichkeit, uns mit ihr zu identifizieren. Besonders nah kommen wir als Leser*in der Figur bei einem Ich-Erzähler.
Das neutrale Erzählverhalten
Der neutrale Erzählverhalten ist die unauffälligste Art des Erzählens und tritt vollständig in den Hintergrund. Es schildert nur, was äußerlich wahrnehmbar ist – ähnlich einer Kamera. Gedanken und Gefühle der Figuren werden nicht direkt mitgeteilt.
Du kannst die den neutralen Erzähler also wie einen Zuschauer vorstellen, der nicht am Geschehen beteiligt ist. Er schildert lediglich, was er sieht, ohne dabei die Gefühle oder Gedanken einer bestimmten Figur zu kennen. Auch gibt er keine Kommentare ab. Stattdessen ist er wie eine Filmkamera, die ohne Wertung abbildet, was geschieht, nur eben nicht visuell, sondern mit Worten. Folglich berichtet der neutrale Erzähler sachlich und objektiv, wir als Leser*innen nehmen das Geschehen also aus einer gewissen Distanz wahr. Das ist ein großer Unterschied zum personalen Erzähler, bei dem wir ja sogar emotional involviert sind.
Merkmale des neutralen Erzählverhaltens
- Der neutrale Erzähler beschreibt nur, was er sieht.
- Er ist neutral und objektiv.
- Er wertet nicht und nimmt keine bestimmte Perspektive ein.
- Dadurch hat er eine gewisse Distanz zum Geschehen. Diese Distanz überträgt sich auch auf uns Leser*innen
- Der neutrale Erzähler tritt in der Er/Sie-Form auf.
Funktion des neutralen Erzählverhaltens
Das neutrale Erzählverhalten wirkt objektiv und beobachtend. Es lässt viel Raum für Interpretation und eine distanzierte Betrachtung der Handlung. Die Leserschaft bekommt dadurch die Möglichkeit, sich komplett ohne Einfluss eine Meinung zu bilden.
| Erzählverhalten | Perspektive | Merkmale | Funktion/Wirkung |
| auktorial | Außensicht | allwissender Erzähler, Kommentare, Vorausdeutungen | Überblick, Einordnung, Einfluss auf Lesersicht |
| personal | Innensicht | erzählt aus Sicht einer Figur, subjektiv, Gedanken und Gefühle zugänglich | Nähe zur Figur, Identifikation, emotionales Miterleben |
| neutral | Außensicht (objektiv) | keine Gedanken, nur äußeres Verhalten, keine Kommentare | Objektivität, Distanz, Interpretationsspielraum für Leser*innen |
Insgesamt lässt sich festhalten: Das Erzählverhalten ist ein zentrales Gestaltungsmittel in literarischen Texten. Es bestimmt, wie nah oder distanziert die Leser*innen die Handlung und die Figuren erleben. Die Wahl des Erzählverhaltens beeinflusst somit maßgeblich die Wirkung des Textes.
Diese Perspektiven kann das Erzählverhalten haben
Kommen wir nochmal auf die anfangs schon erwähnte Unterscheidung zwischen Erzählverhalten und Erzählperspektive zurück. Grundsätzlich gilt: Die Erzählperspektive sagt, aus wessen Augen erzählt wird. Das Erzählverhalten sagt, wie viel dieser Erzähler weiß und wie er sich verhält.
Konkret bedeutet das:
| Erklärung | Arten | Funktion | |
| Erzähl– perspektive = | Standpunkt/Blickrichtung | 1. Ich-Perspektive 2. Er-/Sie-Perspektive 3. Multi-perspektivisch | bestimmt, aus wessen Augen wir das Geschehen wahrnehmen |
| Erzähl- verhalten = | Erzählerhaltung / Grad der Allwissenheit | 1. auktorial 2. personal 3. neutral | bestimmt, wie viel der Erzähler weiß und wie er sich zur Geschichte verhält |
Beispiel zur Veranschaulichung:
Ein Ich-Erzähler (Perspektive!) kann…
- … ein personales Erzählverhalten zeigen, indem er subjektiv nur das schildert, was er erlebt und denkt.
- ein auktoriales Verhalten zeigen, indem er im Rückblick alles weiß und kommentiert.
Ebenso kann ein Er-/Sie-Erzähler in der dritten Person:
- allwissend (auktorial) erzählen. Das bedeutet, dieser Erzähler weiß alles.
- personal erzählen. Der Erzähler nimmt die Sicht einer Figur ein.
- neutral erzählen. Der Erzähler verhält sich unauffällig wie ein stiller Beobachter oder eine Kamera, die das Geschehen aufzeichnet.
Auf einen Blick: das Erzählverhalten
- Das Erzählverhalten beschreibt die Haltung und die Nähe des Erzählers zur Handlung und zu den Figuren.
- Es gibt drei Arten des Erzählverhaltens.
- Ist das Erzählverhalten, auktorial (allwissend, kommentierend), weiß der Erzähler alles und kann in die Handlung eingreifen.
- Beim personalen Erzählverhalten erzählt der Erzähler aus der Perspektive einer Figur und beschränkt sich auf deren Wissen und Erfahrungen.
- Das neutrale Erzählverhalten ist objektiv, beobachtend. Der Erzähler bleibt zurückhaltend und beschreibt nur äußerliche Ereignisse ohne Einblick in die Gedanken der Figuren.
- Das Erzählverhalten hat maßgeblichen Einfluss auf das Leseerlebnis.
- In vielen Texten wechseln Erzähler zwischen verschiedenen Erzählverhalten (z. B. von personal zu auktorial) oder Erzählperspektiven (z. B. zwischen mehreren Figuren). Diese Wechsel sind oft strategisch und beeinflussen den Verlauf und die Wirkung der Geschichte.